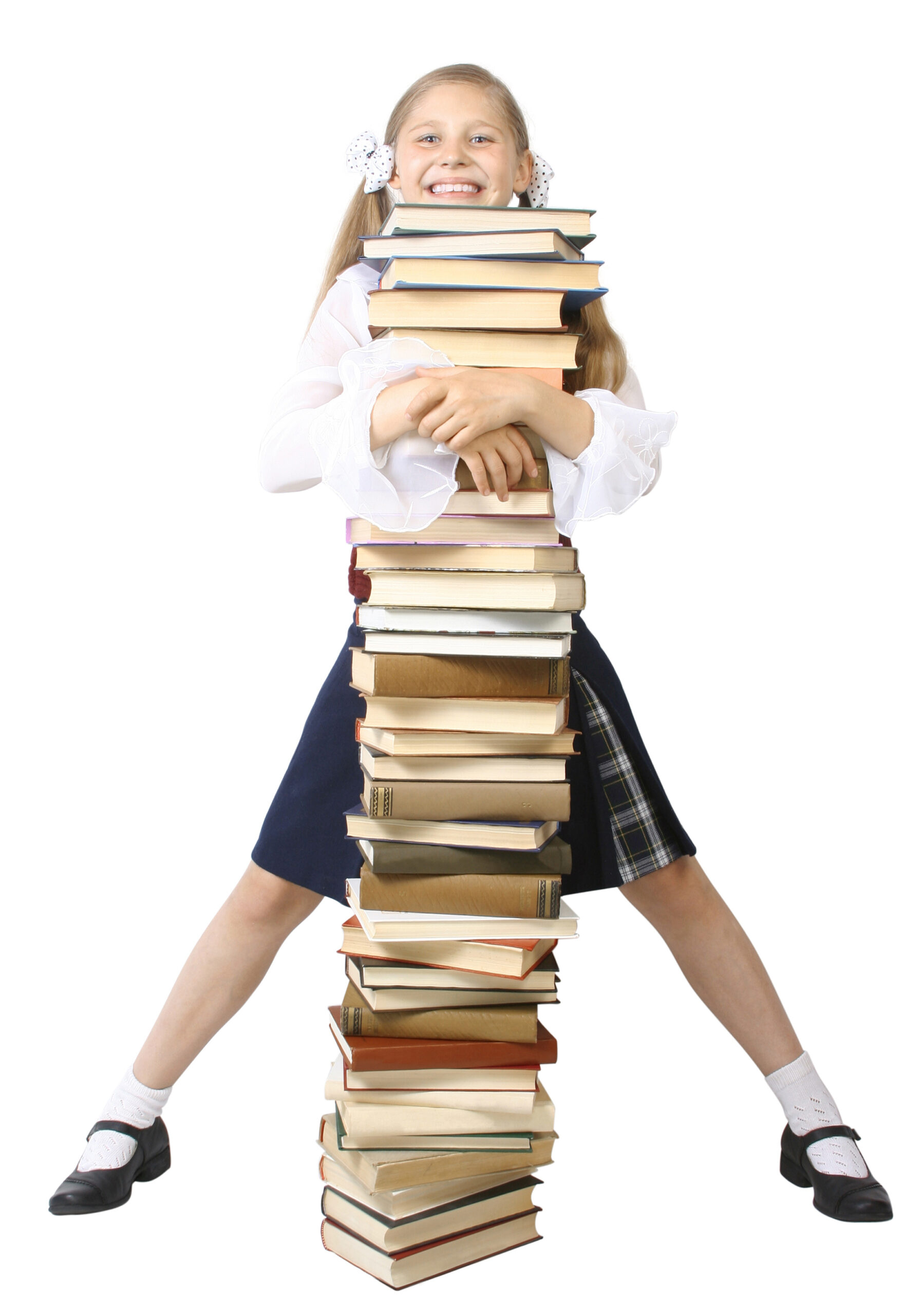Das Bildungsniveau hat ein Allzeithoch erreicht, gegen Zugangshindernisse und niedrige Abschlussquoten muss jedoch mehr getan werden.
Das Bildungsniveau hat ein Allzeithoch erreicht: Etwa die Hälfte (48 Prozent) der jungen Erwachsenen schließt heute in den OECD-Ländern einen tertiären Bildungsgang ab, gegenüber lediglich 27 Prozent im Jahr 2000. Dieser Abschluss ermöglicht in der Regel ein höheres Erwerbseinkommen, eine stabilere Beschäftigung und einen besseren Gesundheitszustand, so eine aktuelle OECD-Studie.
Education at a Glance 2025 bietet vergleichbare nationale Statistiken zur weltweiten Bildungssituation. Der Studie zufolge hat der familiäre Hintergrund jedoch trotz des Anstiegs der Abschlussquoten im Tertiärbereich weiterhin starken Einfluss darauf, wer ein Hochschulstudium aufnimmt. 2023 hatten nur 26 Prozent der jungen Erwachsenen aus Familien mit niedrigerem Bildungsniveau einen Tertiärabschluss, im Vergleich zu 70 Prozent derjenigen aus Haushalten mit höherem Bildungsniveau. Finanzielle Hindernisse und begrenzte schulische und soziale Unterstützung halten Schüler*innen aus benachteiligten Verhältnissen häufig zurück.
Niedrige Abschlussquoten im Tertiärbereich beeinträchtigen außerdem die Rendite öffentlicher Investitionen, verschärfen den Fachkräftemangel und hemmen die Entwicklungschancen. In 32 OECD- und Partnerländern schließen lediglich 43 Prozent der Studierenden ihr Bachelorstudium in der Regelstudienzeit ab. Bei einer Überschreitung der Regelstudienzeit um drei Jahre steigt der Anteil der Absolvent*innen auf 70 Prozent, wobei die Quoten bei Männern mit 63 Prozent niedriger sind als bei Frauen mit 75 Prozent.
„Eine qualitativ hochwertige Hochschulbildung vermittelt den Studierenden die nötigen Kompetenzen, um die Chancen der im Wandel begriffenen Arbeitsmärkte zu nutzen. Zugleich versetzt sie unsere Gesellschaften in die Lage, die strukturellen Veränderungen zu bewältigen, die Bevölkerungsalterung, künstliche Intelligenz, Digitalisierung und ökologische Transformation mit sich bringen“, so OECD-Generalsekretär Mathias Cormann. „Das Bildungsangebot auf die Arbeitsmarkterfordernisse auszurichten, ist entscheidend, da das anhaltende Missverhältnis zwischen Kompetenzangebot und Kompetenznachfrage reale Kosten bei Löhnen und Produktivität verursacht und das individuelle Wohlergehen beeinträchtigt.“
Niedrige Abschlussquoten sind häufig auf eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Studierenden und den Lehrinhalten der Studiengänge, eine unzulängliche akademische Vorbereitung und unzureichende Unterstützungssysteme zurückzuführen. Es wäre hilfreich, die akademische Vorbereitung sowie die Bildungs- und Berufsberatung im Sekundarbereich zu verbessern und tertiäre Bildungsgänge mit klar definierten Kurssequenzen und Fördermaßnahmen für gefährdete Gruppen einzuführen.
Tertiärbildungssysteme sollten auch bei einer Ausweitung des Zugangs strenge Standards aufrechterhalten. Zudem müssen sie Studierende mit unterschiedlicher Vorbildung und unterschiedlichen Berufsvorstellungen gezielt unterstützen.
Die Studie unterstreicht, wie wichtig hoch qualifizierte Lehrkräfte auf allen Stufen für leistungsstarke Bildungssysteme sind, und weist darauf hin, dass es aufgrund des Lehrkräftemangels schwieriger wird, gut ausgebildete Lehrkräfte einzustellen und zu halten.
Eine hohe Fluktuation erschwert die Einstellung von Lehrkräften. In den meisten Ländern, für die Daten zur Verfügung stehen, gehen jährlich 1–3 Prozent der Lehrkräfte in den Ruhestand. In Dänemark, Estland und England verlassen jährlich nahezu 10 % der Lehrkräfte den Schuldienst, wodurch kontinuierlich erhebliche Anstrengungen zur Personalbeschaffung unternommen werden müssen. In Frankreich, Griechenland und Irland verlassen dagegen jedes Jahr weniger als 1 Prozent der Lehrkräfte den Schuldienst, was die Personalstabilität erhöht, aber auch die Möglichkeiten zur Erneuerung des Lehrpersonals einschränkt.
Die Gewinnung von Quer- und Seiteneinsteiger*innen kann dazu beitragen, Engpässe zu mindern und das Kompetenzspektrum des Berufs zu erweitern. 16 der 28 Länder und Volkswirtschaften, für die Daten vorliegen, bieten Personen, die sich beruflich neu orientieren, alternative Einstiegsmöglichkeiten. Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten könnten die Einstellung und Bindung von Lehrkräften weiter fördern.
OECD_Bildungsreport_2025Education at a Glance 2025 analysiert die Bildungssysteme der 38 OECD-Mitgliedsländer sowie von Argentinien, Brasilien, Bulgarien, China, Kroatien, Indien, Indonesien, Peru, Rumänien, Saudi-Arabien und Südafrika.
Weitere Informationen zu Education at a Glance, darunter die Länderprofile und Schlüsseldaten, finden sich unter: https://www.oecd.org/de/publications/bildung-auf-einen-blick-2025_9783763979257.html.
Anfragen von Medienvertreter*innen können an Andreas Schleicher, Leiter der OECD-Direktion Bildung und Kompetenzen (+33 1 45 24 18 97), oder Spencer Wilson im OECD Media Office (+33 1 45 24 97 00) gerichtet werden.
Die OECD ist ein globales Forum, das mit über 100 Ländern zusammenarbeitet. Sie tritt ein für eine Politik, die die individuellen Freiheiten wahrt und das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen der Menschen weltweit fördert.
Quelle: OECD.org